Als Fernpilot trifft man im Umkreis des Schloss Neuschwanstein zwei verschiedene Typen von Menschen an: Die einen sind auf einer längeren Wanderung und wollen gerne einen Blick auf den Controller der Drohne werfen, um rauszukriegen, ob sich der Aufstieg lohnt, die anderen sind auf einer längeren Wanderung und schon dermaßen ausgelaugt, dass sie sich lieber daran abarbeiten wollen, ob man denn hier mit einer Drohne fliegen dürfe oder nicht, denn das wäre doch ganz sicher verboten, schließlich sind wir hier in Bayern, beim Söder!
Unangenehm wird’s dann, wenn jene Wanderwutbürger Google auf ihrem Smartphone befragen und die Google-KI eine rechtlich nicht haltbare Antwort herbeihalluziniert, dass das alles natürlich total verboten wäre, und sich dabei offenbar auf die Aussagen aus diesem Artikel zum Absturz einer Drohne am Schloss und den Regelungen der Bayerischen Schlösserverwaltung stützt.
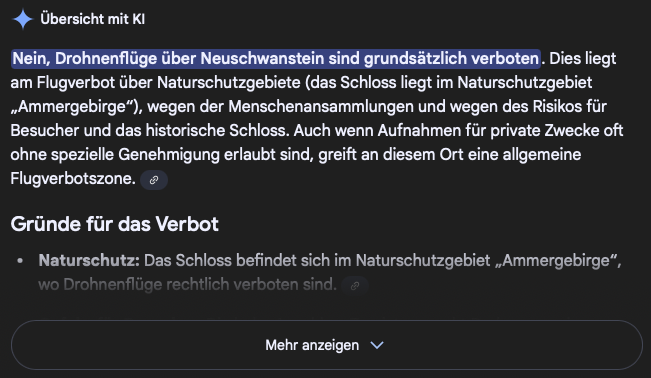
Als Software-Entwickler weiß ich, wie eine Künstliche Intelligenz ihre Buchstaben aneinanderreiht und dass da mitunter ziemlicher Quatsch hinten rausfällt und als verständiger Fernpilot kenne ich natürlich auch die einschlägigen Regelungen für diesen Ort.
Rechtliche Regelungen für Drohnenflüge am Schloss
In den gesellschaftlichen Netzwerken flattern immer mal wieder Screenshots von Mailverkehr mit der Bayerischen Schlösserverwaltung herum, in denen die Verwaltung eine Bitte um eine Flugerlaubnis quasi abschlägig bescheidet und sich dabei auf das Urheberrecht am Schloss als Bauwerk, auf die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Menschen, auf ein mysteriöses Naturschutzgebiet, das es nicht gibt und auf das Hausrecht beruft.
Ich fange mal hinten an: Natürlich kann die Bayerische Schlösserverwaltung mit ihrem Hausrecht aus § 903 BGB untersagen, eine Drohne auf ihrem Gelände zu benutzen, das heißt, zu starten oder zu landen. Sie kann mir aber nicht verbieten, abseits ihres Geländes eine Drohne zu starten.
Da es sich beim Schloss Neuschwanstein aber weder um ein Wohngrundstück noch um ein Industriegelände oder ein anderes geografisches Gebiet im Sinne von § 21h LuftVO handelt, darf ich grundsätzlich mit einer Drohne über das Schloss hinüberfliegen.
Dort kommt dann wieder die Europäische Durchführungsverordnung 2019/947 ins Spiel: Mit einer Drohne der Klasse C0 darf ich über einzelne unbeteiligte Personen fliegen, mit der Klasse C1 nur ganz, ganz kurz. Ab der Klasse C2 ist ein großzügiger Abstand von 30 m, im langsamen Flugmodus von 5 m einzuhalten (UAS.OPEN.030 Abs. 1). Die Anwendung der 1:1-Regel wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben. Der Überflug von Menschenmassen ist mit Drohnen in der offenen Kategorie ohnehin untersagt (UAS.OPEN.020 Abs. 2).
Das heißt aber: Solange dort nur ein paar einzelne Leute herumlaufen, darf ich dort theoretisch mit einer Drohne der Klasse C0 oder C1 fliegen, sofern ich abseits des Geländes der Schlösserverwaltung starte. Das mache ich aber trotzdem nicht, man muss die Leute ja auch nicht unnötig verärgern und für mich steht das Verhältnis zwischen dem Aufwand für solche Flüge und dem resultierenden Bildmaterial in gar keinem Verhältnis.
Das ominöse Naturschutzgebiet „Ammergebirge mit Kienberg und Schwarzenberg sowie Falkenstein“ befindet sich zwar recht nah südlich des Schlosses, ist aber noch weit genug entfernt, um locker mit einer Drohne zwischen Naturschutz und Schloss herumzufliegen. Da hat auch die Google-KI-Antwort nicht genau auf die Karte geschaut.
Der urheberrechtliche Schutz am Bauwerk ist nach meinem Dafürhalten ohnehin längst erlöschen, weil Eduard von Riedel, der Architekt des Schlosses, 1885 in Starnberg gestorben ist. 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers erlöschen die Urheberrechte kraft § 64 UrhG, das war also bereits 1955 der Fall. Selbst wenn ich erwäge, dass beispielsweise Georg von Dollmann urheberrechtlich schützenswerte Einzelheiten zum Gesamtkunstwerk beigetragen hat, verschiebt das die Sache nur um zehn Jahre, denn er starb 1895.
Grundsätzlich hat die Schlösserverwaltung aber recht: Auch Bauwerke genießen dank § 2 UrhG urheberrechtlichen Schutz, sofern der Urheber noch nicht länger als 70 Jahre tot ist, und dürfen demnach nur dank der Panoramafreiheit als Foto veröffentlicht werden.
Die Panoramafreiheit aus § 59 UrhG wiederum gilt nur für Perspektiven, die für mich als Fotografen ohne Hilfsmittel von öffentlichen Flächen einzusehen sind. Eine hohe Leiter, ein langes Stativ oder eben eine Drohne sind ein solches Hilfsmittel, so dass ich hier die Panoramafreiheit nicht geltend machen kann — was aber egal ist, denn mit Riedels Tod vor 140 Jahren ist der urheberrechtliche Schutz quasi schon doppelt abgelaufen.
(Ob sich Reidel wohl hat träumen lassen, dass sein Werk irgendwann von hunderttausenden Touris pro Jahr besucht und fotografiert wird?)
Auch die Argumentation mit den Persönlichkeitsrechten ist nicht verkehrt und ich könnte hier noch eine ganze Menge weiterer Absätze zu dieser Thematik herunterrasseln, begnüge mich aber mit einer Annahme: Selbst mit dem Teleobjektiv der Drohne sind die abgebildeten Menschen so klein, dass erkennbare Persönlichkeitsmerkmale wie Körperhaltung, Frisur oder Kleidung selbst in einer 100-%-Ansicht des Fotos nicht mehr auszumachen sind, geschweigedenn dass Gesichter in irgendeiner Form erkennbar sind.
Ich halte es hier mit § 23 Abs. 1 Nr. 2 KunstUrhG: Die Menschen vor und neben dem Schloss sind allenfalls als Beiwerk und überdies nicht in erkennbarer Größe dargestellt.
Abgesehen davon gelten Persönlichkeitsrechte auch bei „normalen“ Fotografien mit einer Kamera oder Smartphone, ich halte sie insofern für ein nicht besonders starkes Argument gegen Drohnenaufnahmen — es geht hier schließlich nicht darum, Menschen in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich, beispielsweise ihrem mit einer Hecke umschlossenen Garten beim Sonnenbad zu beobachten, sondern um Fotos von einem der meistfotografierten Gebäude der Welt.
Und von diesem Gebäude habe ich nun auch ein paar Drohnenfotos und nicht mal der Söder kann etwas dagegen unternehmen.
Probleme im Flugraum rund ums Schloss
Bezüglich des Luftraums rund um Schloss Neuschwanstein möchte ich gerne drei Themen erwähnen: Die in den Einstellungen konfigurierbare Flughöhe einer Drohne, die Paraglider, die im Bereich des Schlosses fliegen, und kleine Flugzeuge.
Eine gewisse Hürde für einen Fernpiloten am Schloss Neuschwanstein dürfte die Einhaltung der maximalen Flughöhe von 120 m über Grund sein, die in UAS.OPEN.010 Abs. 2 vorgeschrieben wird, über dem zerklüfteten Gelände rund um das Schloss Neuschwanstein. Ich habe mich für den Flug an einer topografischen Karte orientiert und die jeweils maximale Flughöhe konservativ abgeschätzt.
Hier kommt dann auch eine Besonderheit der unterschiedlichen Drohnenklassen zum Tragen: Wenigstens DJI-Drohnen berechnen ihre Flughöhe immer relativ zum Startpunkt. Bei einer kleinen Drohne der Klasse C0 wiederum lässt sich die maximale Flughöhe nicht über 120 m erhöhen — damit kommt die Drohne dann noch nicht einmal bis zum Fuß der Burg.
Ab der Klasse C1 wiederum lässt sich wenigstens bei DJI-Drohnen eine Flughöhe von einem Kilometer einstellen, so dass man vorsichtig, immer in einer Höhe von maximal 120 m über Grund den Berg hinaufkraxeln kann. Hier ist dann auch die Rückkehrfunktion der Drohne mit Vorsicht zu verwenden, denn die wird vermutlich eine Route wählen, die nicht dem Höhenprofil des Gebirges folgt, sondern in der aktuellen Höhe zum Startpunkt zurückkehren und damit dann im Zweifelsfall lockere 300 m über Grund unterwegs sein.
Ich verstehe übrigens auch gar keinen Spaß dabei, für ein gutes Drohnenfoto die maximale Flughöhe von 120 m über Grund zu überschreiten. Hier sind nicht nur Paraglider unterwegs, die ohnehin tiefer als 120 m fliegen, sondern auch einige Kleinflugzeuge, die vermutlich für ein paar schöne touristische Aufnahmen des Schlosses extrem tief unterwegs sind. Gemäß SERA.5005 Buchstabe f gilt bei bebautem Gebiet, was hier aufgrund des angrenzenden Städtchens Hohenschwangau einschlägig sein dürfte, eine Mindestflughöhe von 300 m über dem nächsten Hindernis im Umkreis von 600 m.
Ich rechne mal kurz herum: Der Fuß des Schlosses befindet sich auf einer Höhe von 950 m über Normalhöhennull, der höchste Turm ist 65 m hoch, plus 300 m ergibt das eine Flughöhe von 1.315 m über Normalhöhennull, beziehungsweise am Fuß des etwa 130 m hohen Felsens eine Höhe von 495 m über Grund. Insofern war ich durchaus überrascht, dass ich in einer Entfernung von 250 m Luftlinie vom Schloss von Kleinflugzeugen überflogen wurde, die per ADS-B mit einer Flughöhe von 80 m über Grund auswiesen.
Nun mag es natürlich sein, dass die Piloten mit einer Tieffluggenehmigung unterwegs waren, klar, allerdings fehlt mir auch das Verständnis, warum man so tief am Schloss vorbeifliegen möchte. Diese Fotoperspektive hätte sich ja schon beinahe vom Boden aus ergeben, dazu hätte man kein Flugzeug benötigt.
So oder so hat es mich als Fernpilot aber auch gar nicht zu interessieren, ob das bemannte Luftfahrzeug dort fliegen darf oder nicht. Hier sticht auf jeden Fall die heilige Regel aus UAS.SPEC.060 Abs. 3 Nr. b: Bemannter Luftfahrt ist immer auszuweichen, ganz gleich, ob sie so tief fliegen darf oder nicht.
Insofern möchte ich noch einmal darauf hinweisen: Lasst eure Drohne nur so weit fliegen, wie ihr sie noch erkennen könnt, so wie es die Vorschriften zum Fliegen auf Sicht verlangen, und behaltet zusätzlich den Luftraum rund ums Schloss im Auge. Bei gutem Wetter springen regelmäßig Paraglider vom benachbarten Tegelberg, die von dort aus nur zwei Kilometer bis zum Schloss zurücklegen müssen.
Ich war bei meinem ersten Besuch selbst überrascht, wie schnell der Luftraum voller Paraglider ist: Man schaut einmal kurz auf den Controller, Zack, schon sind sie alle da. Ich unterstelle einmal, dass wir alle am Schloss Neuschwanstein herumfliegen, weil wir gerne einen schönen Tag und ein paar schöne Fotos haben wollen, also lasst uns Fernpiloten zusehen, nicht als Unfallverursacher in der Zeitung aufzutauchen. Ich halte es für sinnvoll, den Tegelberg im Blick zu behalten und spätestens eine Minute nach Absprung eines Paragliders mit der Drohne den geordneten Rückzug anzutreten, bevor der Flieger auch nur in der Nähe meines Flugbereiches ankommt.
Die Wahl des Start- und Landeplatzes
Tja, wo startet man nun seine Drohne? Mit Blick auf das Gelände, die VLOS-Vorschriften und die geografischen Gebiete rund um das Schloss bleiben eigentlich nur einige Bereiche nördlich und nordöstlich des Schlosses, von wo aus sich mit der Drohne der Berg erklimmen lässt.
Man kann natürlich auch aus dem Wald südwestlich des Schlosses starten. Das halte ich allerdings für eine ungünstige Idee, hat man von dort aus doch eher einen schlechten Blick auf Paraglider und Kleinflugzeuge und läuft überdies Gefahr, unbeteiligte Personen zu überfliegen, was ja wenigstens mit einer größeren C2-Drohne tunlichst zu unterlassen ist.
Wenn ihr meint, euch im Wald verstecken zu müssen, damit euch oder eure Drohne niemand findet oder gar anspricht: Dann lasst es vielleicht besser bleiben. Ich finde, wer hier mit einer Drohne das Schloss fotografieren oder filmen möchte, sollte auch das notwendige Selbstbewusstsein und die passende Trittsicherheit in rechtlichen Fragen mitbringen, um einem Gespräch mit anderen Personen oder der Ordnungsmacht gelassen entgegen zu sehen.
Ein Startpunkt im Wald bringt nur Probleme mit sich: Der Funkkontakt zwischen Controller und Drohne ist aufgrund des vielen Blattwerkes etwas schlechter, was womöglich einen Verbindungsabbruch und daraus resultierend ein Return-to-Home-Manöver verursacht, bei dem dann die Drohne erstmal die maximale Flughöhe über Grund überschreiten könnte (was vermutlich da noch die kleinste Sorge ist), um dann den Wald Landeplatz vor lauter Bäumen nicht zu sehen — und von dort aus lässt sich der Luftraum hinsichtlich der bereits mehrfach erwähnten Paraglider und Kleinflugzeuge nicht beobachten.
Die Nutzung öffentlicher Flächen der Stadt Füssen für Drohnenflüge scheint übrigens unproblematisch zu sein. Die Stadt hat auf ihrer Website einen eigenen Bereich zum Thema Drohnenflüge eingerichtet, in dem auch noch einmal betont wird, dass Drohnenaufnahmen der Königsschlösser grundsätzlich nicht gestattet seien. Das sehe ich — wie bereits oben ausführlich erläutert — etwas anders.
Relevanter ist allerdings, was die Stadt Füssen auf ihrer Website nicht schreibt: Sie besteht offenbar nicht darauf, Drohnenflüge mit den zuständigen Ordnungsbehörden abzustimmen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen der Rechtslage, ob das Starten und Landen einer Drohne auf öffentlichen Flächen — etwa auf einer Straße oder einem Wanderweg — noch dem gewidmeten Gemeingebrauch entspricht, beziehungsweise unterschiedliche Herangehensweisen, ob das Amt den Betrieb einer Drohne achselzuckend duldet oder darin ein ganz großes Problem sieht.
Mit meinen mittlerweile zweijährigen Erfahrungen und unzähligen Kontakten zu Ordnungsbehörden halte ich es so, dass ich mich während der Flugvorbereitung informiere, ob die jeweilige Stadt auf ihrer Website etwas zum Thema Drohnen veröffentlicht hat und ob sie möchte, dass Flüge vorab beim Amt oder der Polizei gemeldet werden.
Die Hansestadt Lübeck beispielsweise stellt gerne eine kostenpflichtige Drehgenehmigung aus, die Hansestadt Bremen wollte früher einmal per E-Mail informiert werden (und war dann ganz erstaunt, als ich tatsächlich eine Mail geschickt hatte), während viele andere Städte private, teils auch gewerbliche Drohnenflüge noch vom Gemeingebrauch gedeckt sehen — oder sich einfach nicht dafür interessieren.
Eine eventuelle Allgemeinerlaubnis für Drohnenflüge kann wiederum die Auflage enthalten, Drohnenflüge mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Der Freistaat Bayern bietet allerdings keine Allgemeinerlaubnis an, insofern ist das wenigstens in diesem Bundesland nicht relevant.
Und da die Stadt Füssen offensichtlich nicht über Drohnenflüge informiert werden will, möchte ich sie auch nicht weiter behelligen.
Mein Fazit
Ich halte es für unproblematisch, Drohnenfotos beispielsweise aus folgender Perspektive aufzunehmen und zu veröffentlichen, sofern man den Luftraum im Blick hat. An dieser Position gibt es keine geografischen Gebiete, die einem Drohnenflug widersprechen könnten, die Persönlichkeitsrechte der zwei oder drei Pixel groß abgebildeten Menschen bleiben gewahrt und eine Gefahr für Leib und Leben halte ich aus dieser Distanz für ausgeschlossen: Wenn meine Drohne ins Straucheln gerät, dann liegt sie unerreichbar irgendwo auf einer Klippe im Gebirge, aber wird niemals auch nur in die Nähe des Schlosses stürzen.


Vor anderen Perspektiven habe ich größeren Respekt, weil ich dazu meine Drohne unzulässigerweise aus dem VLOS-Bereich herausfliegen müsste, sie also nicht mehr im Blick hätte, oder nicht mehr garantieren könnte, dass sich unter meiner dicke C2-Drohne keine unbeteiligten Personen aufhalten.
Vielleicht ist es aber auch gar keine schlechte Idee, wenn sich gerade bei Touris und unbedarften Fernpiloten die Erkenntnis durchsetzt, dass man hier gar nicht fliegen dürfe. Dann kommt auch niemand auf die Idee, schnell und ohne ausführliche Flugplanung die Drohne im Schlosshof zu starten und sich zu wundern, warum die ganze Sache plötzlich teuer wird.



2 comments